Grundlagen und Ursachen
Aus psychoanalytischer Sicht entsteht Hypochondrie durch innere Konflikte, die durch Schuldgefühle oder Angst verursacht werden. Zur Abwehr dieser Konflikte wird die Aufmerksamkeit auf körperliche Störungen verschoben, so dass eine Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden Konflikten nicht mehr notwendig ist. Es wird angenommen, dass die körperlichen Beschwerden symbolischen Charakter haben, so könnten z.B. Augenprobleme als Ausdruck dafür stehen, etwas „nicht sehen“ zu wollen. Diese Annahme spiegelt sich auch in Ausdrücken wie „Mir ist etwas auf den Magen geschlagen“ oder „Das bereitet mir Kopfschmerzen“ wider.
Es ist wahrscheinlich, dass Hypochondrie durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren entsteht, die sich gegenseitig beeinflussen
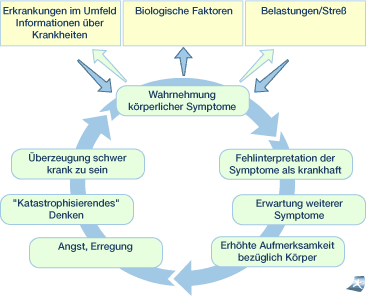
Vor dem Ausbruch der Erkrankung sind die Betroffenen meist mit Informationen über Krankheiten in Kontakt gekommen, z.B. dadurch, dass eine Person aus dem Umfeld schwer erkrankt ist oder durch Berichterstattungen in den Medien. Personen, die an Hypochondrie erkranken, zeigen oft schon vor Krankheitsbeginn eine hohe psycho-physiologische Reaktivität, d.h. zum Beispiel, dass sie auf Reize besonders schnell mit erhöhtem Herzschlag reagieren. Häufig berichten Betroffene, dass sie vor dem Auftreten der hypochondrischen Symptome unter Stress standen oder einschneidende Veränderungen in ihrem Leben eingetreten sind.
Hypochonder neigen zum "katastrophieren"
Unter diesen Umständen führt die Wahrnehmung körperlicher Erscheinungen, wie unregelmäßiger Herzschlag, Schwindelgefühle, Verdauungsprobleme oder Kopfschmerzen, die als vorübergehende Beschwerden völlig normal sind oder auf die erhöhte Belastung zurückgehen, zu der Annahme, dass diese Symptome Zeichen einer schweren Erkrankung sind. Es zeigt sich, dass hypochondrische Patienten eine besonders niedrige Schwelle für körperliche Reize haben, also z.B. ihren Puls leichter wahrnehmen können als andere Personen. Die Idee krank zu sein führt zu der Erwartung, dass weitere Beschwerden auftreten werden, woraufhin die Betroffenen ihr körperliches Befinden sehr genau beobachten. Durch die Hinwendung zu möglichen Symptome und die daraus folgende Angst und Anspannung entsteht eine erhöhte physiologische Erregung - für die Patienten ein weiterer Beleg für ihre Krankheit. Hypochondrische Patienten neigen dazu zu „katastrophisieren“, d.h. Ereignisse extrem negativ zu bewerten. So sehen sie die wahrgenommenen Symptome nicht als die einzelnen Beschwerden, die sie sind, sondern als Zeichen einer schweren Erkrankung. Diese entspricht oder ähnelt häufig der Krankheit, von der sie vor Beginn der Symptome durch ihr Umfeld oder die Medien gehört haben. Die Betroffenen befinden sich in einem Teufelskreis: Die Gewissheit, krank zu sein erhöht ihren Stress und steigert die Aufmerksamkeit für ihre Beschwerden; meist versuchen sie in der Fachliteratur mehr Informationen über ihr Leiden zu finden - diese Faktoren wiederum führen dazu, dass weiterhin vermehrt Symptome wahrgenommen werden und verstärken die Überzeugung, an einer bestimmten Erkrankung zu leiden.
Zusätzlich stellen sich häufig Begleiterscheinungen ein, die zur Aufrechterhaltung der Hypochondrie beitragen: Viele der Betroffenen schonen sich aus Sorge um ihre Gesundheit, dadurch wird ihre körperliche Belastbarkeit vermindert, so dass sie auch auf kleinere Anforderungen tatsächlich mit körperlichen Beschwerden reagieren. Zudem begegnet die Umwelt dem Leiden des Patienten meist mit Unterstützung; so werden Besorgungen für ihn erledigt oder er erfährt Mitleid und Zuwendung. Ohne das der Betroffene dies absichtlich einsetzt, wird er so für seine Beschwerden „belohnt“.
Verlauf
Grundsätzlich kann Hypochondrie in jedem Lebensalter beginnen, häufig tritt die Symptomatik aber zum ersten Mal im frühen Erwachsenenalter auf. Der Krankheitsverlauf ist oft chronisch, so dass die starke Beschäftigung mit körperlichen Beschwerden zu etwas wie einem Persönlichkeitsmerkmal des Betroffenen wird. Das Andauern der Erkrankung ist dann recht wahrscheinlich, wenn sie schleichend begonnen hat und der Betroffene durch sie bestimmte „Vorteile“ (z.B. Schonung, Aufmerksamkeit) genießt.
Therapie
Aufgrund der Überzeugung, schwer körperlich erkrankt zu sein, begeben sich hypochondrische Patienten nur selten oder erst nach einem langen Krankheitsverlauf in psychotherapeutische Behandlung. Häufig wenden sie sich zunächst an ihren Hausarzt oder Internisten. Die Behandlung dieser Patienten ist für den Arzt oft ein Balanceakt: Es sollte eine gründliche Untersuchung stattfinden, da die geschilderten Symptome wirklich Hinweise auf eine körperliche Erkrankung sein können. Oft ist für den Arzt aber recht schnell klar, dass die Beschwerden des Betroffenen keinen Krankheitswert haben. Der Patient wird diesen Befund aber anzweifeln und weitere Untersuchungen fordern. Lässt sich der Arzt trotz der Gewißheit, dass auch diese nicht zu Ergebnissen führen werden, auf die Forderung ein, unterstützt er damit die Überzeugung des Hypochonders, an einer besonders schwer zu entdeckenden Krankheit zu leiden. Lehnt er die Forderung ab, wird der Betroffene wahrscheinlich den Arzt wechseln. Generell sollte beim Umgang mit hypochondrischen Patienten betont werden, dass die geschilderten Symptome medizinisch unbedenklich sind. Die Gefahr besteht, dass Betroffene dies als „Beschönigung“ erleben. Für den Arzt ist es deshalb wichtig zu beachten, dass der Patient tatsächlich leidet - wenn auch nicht körperlich, so doch an einer psychischen Erkrankung. Wenn möglich sollte dem Betroffenen deshalb zu einer psychotherapeutischen Behandlung geraten werden. Es muss dabei allerdings mit dem Misstrauen des Patienten gerechnet werden, dass der Arzt selbst nicht mehr weiter weiß und ihn deshalb für „verrückt“ erklärt.
Psychotherapie
Auch in der Psychotherapie ist ein vorsichtiges Vorgehen notwendig. Der Therapeut sollte sich die Symptome des Patienten anhören, ohne mit ihm darüber zu diskutieren, ob diese Beschwerden wirklich existieren. Vielmehr sollte darauf hingewiesen werden, dass in der Therapie ein Umgang mit dem Leiden erlernt werden kann, dass z.B. Entspannungsverfahren wie das Autogene Training eine Hilfe sein können. Auch sollte der Zusammenhang zwischen Stress und körperlichem Befinden deutlich gemacht werden. Im Laufe der Behandlung wird mit dem Patienten erarbeitet, wann die Symptomatik sich verändert und mit welchen Situationen wie z.B. Konflikte in der Familie oder eine hohe Arbeitsbelastung, diese Veränderungen in Verbindung stehen könnten. Dem Betroffenen wird anhand des Erklärungsmodells für Hypochondrie verdeutlicht, wie seine ängstliche Selbstbeobachtung zu einer Steigerung der Symptomatik führt. Die Therapie beschäftigt sich auch mit der Neigung des Betroffenen, Ereignisse eher negativ wahrzunehmen und es wird versucht positivere Denkmuster zu entwickeln. Stellt der Behandler fest, dass das Umfeld stark in die Krankheit des Patienten eingebunden ist, ist es sinnvoll, mit diesen Personen zusammenzuarbeiten und ihnen zu verdeutlichen, dass sie durch eine zu starke Unterstützung und Schonung langfristig zum Bestehenbleiben der Hypochondrie beitragen.
Morbus Clinicus
Eine in der Regel harmlose Vaiante bildet der so genannte morbus clinicus, der u.a.bei Medizinsstudenten und Medizinstudentinnen oder Krankenschwesterschülerinnen auftritt. Dieser Personenkreis entdeckt regelmäßig die Symptome von Erkrankungen bei sich, die gerade Thema einer Vorlesung oder der Ausbildung waren. Normalerweise legt sich diese Art von Symptomen von selber wieder. Aber hin und wieder kann sie auch in eine echte Hypochondrie übergehen.